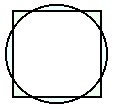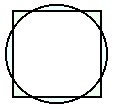Schnurkeramische Neufunde aus dem nördlichen Oberbayern
- Als Mitarbeiter des BLfD im Frühjahr 1987 die Privatsammlung des Heimatforschers F. Rose für das zukünftige Museum in Kösching inventarisierten, entging den Bearbeitern angesichts der immensen Fundmenge ein interessantes Objekt. Erst im vergangenen Jahr kam es bei Archivierungsarbeiten für die neue Kompaktusanlage wieder zum Vorschein und wurde nun als Halbfabrikat einer schnurkeramischen Axt erkannt. Da Artefakte dieser Kultur in der Region nicht gerade zu den alltäglichen Funden gehören, soll das Stück nunmehr hier vorgestellt werden, vor allem, weil es auch einige interessante Hinweise hinsichtlich der steinzeitlichen Axtherstellung zu liefern vermag.
- Auf den ersten Blick recht unscheinbar und den Eindruck eines länglichen Flußgerölls vermittelnd, offenbart sich doch bei einer genaueren Betrachtung der eindeutig artifizielle Charakter des Objektes, das im wesentlichen auch schon die Proportionen und Formen des fertigen Gerätes erkennen läßt (Abb. 1).

- Abb. 1: Das Halbfabrikat einer schnurkeramischen Axt vom Gradhof, Gde. Kösching.
- Auf der Oberfläche zeigt das Stück leichte Verrundungen, und es weist auf den Breitseiten eine unterschiedliche Farbgebung auf. Die eine Hälfte ist schmutzigbraun, wohingegen die andere blaßgrün ist.
Wahrscheinlich ist die braune Oberflächenfarbe durch eine nicht sehr kräftige Feuereinwirkung entstanden, wofür auch einige winzige Fissuren im Gestein sprechen. Einen Blick in das verarbeitete Rohmaterial erlauben mehrere kleinere Beschädigungen, die der Pflug verursacht hat; in diesem Fall für die Gesteinsbestimmung eine willkommene Fremdeinwirkung.
Erkennbar wird dadurch ein lindgrünes Gestein mit dunkelgrünen Olivineinschlüssen bis maximal 0,5 mm Größe. Weitere Gesteinskomponenten sind makroskopisch nicht festzustellen.
Versuche, die Härte des Materials zu bestimmen, ergaben einen Wert von ungefähr 6-6,5 auf der Härteskala von Mohs. Homogenität, Farbe, Zusammensetzung und Härte lassen demnach an ein Gestein denken, welches am ehesten als eine Art Nephrit bezeichnet werden kann.
Nach Lage der Dinge wird man als Ausgangsform einen Flußschotter annehmen müssen, da Lagerstätten dieses Rohstoffes in der näheren Umgebung nicht existieren.
- In seinem heutigen Zustand ist das Halbfabrikat 850 g schwer und besitzt eine Länge von 171 mm. In der Seitenansicht zeigt sich eine fast gerade Unterseite, die zum Nacken hin leicht einzieht, wohingegen die Schneidenpartie in geringem Maße kielförmig auslädt.
Interessant ist der Schneidenverlauf, der von der Unterseite im schrägen Bogen zur Oberseite nach rückwärts verläuft (Abb. 1). Dies ist ein morphologisches Detail, welches seine direkte Entsprechung auch an dem fertigen Stück von Gaimersheim findet (Abb. 2). Die Bearbeitung des Nackenteils ist ebenfalls schon annähernd abgeschlossen. Sein Querschnitt schon deutlich rund gearbeitet und hat einen Durchmesser zwischen 45 und 46 mm.
- Die Durchlochung einer Axt wurde für gewöhnlich ungefähr bei zwei Drittel der Axtlänge, gemessen von der Schneide, angebracht. Die Stabilität des Artefaktes wird durch die Bohrung sehr geschwächt, da durch sie eine ungewollte Sollbruchstelle entstand. Der Hersteller versuchte dieser Gefahr entgegenzuwirken, indem er an dieser Stelle seitlich mehr Material stehen ließ, um der Axt gerade dort eine höhere Stabilität und Festigkeit zu verleihen. Gesteigert werden konnte die Festigkeit auch noch durch einen Wulst auf der Oberseite. Beide Möglichkeiten einer Stabilitätsverbesserung wurden am vorliegenden Exemplar in aller Deutlichkeit genutzt. Von der Unterseite gemessen verdickt sich die Höhe des Stückes von 57 mm im Schneidenbereich auf 62,5 mm im Bereich der zukünftigen Bohrstelle.
In der Aufsicht verbreitert sich der Axtkörper am Übergang vom Schneiden- zum Schäftungsteil von 46 mm auf 59 mm. Gerade diese, für die Stabilität zwingend notwendige Maßnahme ergibt im Grunde erst die charakteristische Form einer frühen schnurkeramischen Axt.
- Wer einmal versucht hat, ein Flußgeröll aus zähem Gestein zu bearbeiten, wird sich nach der Artefaktbeschreibung mit Recht gefragt haben, wie denn der urgeschichtliche Mensch solche Rohstoffe formen konnte.
- Das gesamte Stück trägt nun deutliche Bearbeitungsmerkmale in Form von sogenannten Pickmarken, die in schematischer Form auch auf der Zeichnung dargestellt wurden. Der Rohling wurde also mit der Picktechnik in die vorliegende Form gebracht. Diese Bearbeitungstechnik beruht auf dem Zerrüttungsprinzip und ist besonders für die Verarbeitung von zähen Massengesteinen jeglicher Art geeignet. Man benötigt dazu einen Schlagstein aus möglichst hartem Gestein, am besten aus einem Material, das härter als das zu verarbeitende Rohmaterial ist. Mit der Hand geführt zermürbt man mit schnellen, gezielten Schlägen die zu reduzierenden Stellen (Feustel 1973, 65 f.; Weiner 1987, 54 f.).
Dieser Vorgang ist äußerst zeitaufwendig und dürfte bei dem vorliegenden Stück, vor allem mit Blick auf die Härte von Nephrit, schon eine geraume Zeit gedauert haben, zumal die Form der einer fertigen Axt schon sehr nahe kommt.
Kennzeichnend für diese Art der Gesteinsbearbeitung sind eben die Pickmarken, mit denen das Stück völlig bedeckt ist. Das Picken, das der Axt die gewünschte Form hätte geben sollen, wurde aber aus nicht bekannten Gründen vorzeitig beendet. Möglicherweise mußte sich der Bearbeiter den Vorgaben des Rohstücks beugen und sah vielleicht keine Möglichkeit mehr, dieses in die optimale Form bringen zu können. Es ist zudem zu bedenken, daß eine weitere Feinbearbeitung durch Schleifen und der abschließende Bohrvorgang angesichts der Härte des Gesteins nur unter Aufbietung großer Anstrengungen hätte gemeistert werden können.
- Es stellt sich in diesem Zusammenhang die Frage, in welcher Reihenfolge die verschiedenen Arbeitsgänge aufeinander folgten.
Gelegentlich wird darauf verwiesen, daß nach einer ersten Vorbereitung des Rohstücks die Durchbohrung vorgenommen wurde, da diese nicht nur sehr zeitaufwendig war, sondern auch nicht selten eine Weiterverarbeitung des Werkstücks unmöglich machte. So kam es beim Bohren nicht selten zu Sprüngen im Gestein oder sogar zum Zerbersten des Rohstücks. Unter Berücksichtigung des gesamten Fertigungsprozesses scheint diese prinzipiell einsehbare Vorgehensweise aber nicht sinnvoll, da das noch unförmige Werkstück durch die Bohrung entscheidend geschwächt würde. Bei der dann folgenden Bearbeitung mit der Picktechnik, die eine sehr große kinetische Energie freisetzt, der das Stück auch an seinen schwächsten Stellen ausgesetzt ist, würde der Rohling mit ziemlicher Sicherheit zerbrechen. Es liegt daher auf der Hand, den Bohrvorgang erst nach der endgültigen Formherstellung vorzunehmen.
- Weshalb nun das Halbfabrikat vom Gradhof nicht vollendet wurde, entzieht sich naturgemäß unserem Wissen, doch können verschiedene Gründe angeführt werden, die vor allem im technischen Bereich liegen. So weist das Stück einige, offenbar durch das Picken verursachte Abplatzer auf, die der Bearbeiter nicht mehr hätte korrigieren können, ohne dabei die angestrebte Form nachhaltig zu verändern. Ob dieser mehr optische Makel allerdings der Auslöser war, ist natürlich nicht zu entscheiden, wenngleich es eher unwahrscheinlich ist. Schwerwiegender und vermutlich auch für die Aufgabe des Stücks ausschlaggebend dürfte die große Härte des gewählten Gesteins gewesen sein. Zur Auswahl dieses Gerölles könnte es gekommen sein, weil es schon eine von der Natur vorgegebene, längliche Form besaß und der Arbeiter sich davon unter Umständen eine Zeitersparnis versprach. Erst nach dem Arbeitsbeginn wird er die außergewöhnliche Härte des Materials bemerkt haben.
- Ob nun nach der ersten Formgebung als nächstes die Durchbohrung oder zunächst eine, zur endgültigen Formung notwendige Feinbehandlung durch Schleifen vorgenommen werden sollte, ist aus dem Bearbeitungsstand des Halbfabrikats nicht abzuleiten. Zur Beantwortung dieser Frage kann unter Umständen die Axt aus Gaimersheim beitragen. Eine weitere Bearbeitung mit feineren Techniken hätte aber auf jeden Fall noch stattfinden müssen. Zu denken wäre hier natürlich in erster Linie an die Schleiftechnik, die aber für die Steinzeit bisher meist nur mit der Bearbeitung großer Flächen, etwa der Breitseite eines Silexbeiles, in Verbindung gebracht wurde.
- Äxte der vorliegenden Art sind aber gekennzeichnet von einer runden Gestaltung; nirgendwo am gesamten Axtkörper gibt es eine wirklich größere Fläche, die nicht in irgendeinem Radius geformt wäre.
Dieser Umstand macht es nun in der Tat schwierig, die notwendige Feinarbeit mit einem liegenden Schleifstein durchzuführen.
Bestenfalls für den Schneiden- und Nackenbereich wäre ein Einsatz der herkömmlichen Schleifmethode möglich. Tatsächlich sind auch genau dort die einzigen Schliffacetten zu sehen (Abb. 1). Alle anderen Teile der Axt konnten aber nicht auf einem flachen Schleifstein geschliffen werden. Hierzu benötigt der Hersteller handlich zugerichtete Sandsteinstücke, die sich effektiv mit der Hand führen ließen, die wahrscheinlich zur besseren Handhabbarkeit auch mit Leder o. ä. umwickelt waren. In der einen Hand hielt man nun den »mobilen« Schleifstein und in der anderen das Werkstück.
Sofern der Bearbeiter nun über etwas handwerkliches Geschick verfügte, konnte er Werkzeug wie Werkstück optimal zueinander in Position bringen.
Um diese Technik zu erschließen, muß man einige fertige Äxte dieses Zeithorizontes im Original betrachtet haben. Ein überwiegender Teil von ihnen weist nun eine Eigenheit auf, die dem Gradhofer Stück fehlt: sie alle sind aus einem beträchtlich weicheren Gestein angefertigt worden, nicht selten aus Serpentinit oder aus mit diesem vergleichbaren Gesteinen, die eine Mohshärte zwischen 4 und 5 besitzen. Solche Gesteine ließen außer der beschriebenen Handschleiftechnik sogar eine Bearbeitung mit einfachen Silexabschlägen zu, die schabend eingesetzt wurden.
- Das schon durch die Pickarbeit weit vorangeschrittene Werkstück deutlich vor Augen, sah sich der Bearbeiter jedoch nun vor die Aufgabe gestellt, auch noch die Feinbearbeitung und die Durchbohrung vorzunehmen. Man wird davon ausgehen dürfen, daß er zu diesem Zeitpunkt bereits in der Lage war, in etwa abzuschätzen, wieviel Zeit ihn diese Arbeiten kosten würden. Möglicherweise übertraf die noch benötigte Arbeitszeit den vereinbarten »Lohn«, und das Geschäft war nicht mehr lukrativ. In solchen Fällen wird man damals kaum anders als heute reagiert haben: Man stellte die Produktion ein.
- Andreas Tillmann
- Schnurkeramische Neufunde aus dem nördlichen Oberbayern
- Sammelblatt des Historischen Vereins Ingolstadt, 1990. S. 77-91.
- Bearbeitung: Kurt Scheuerer
- Siehe auch:
|